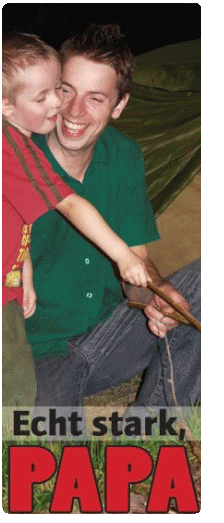|
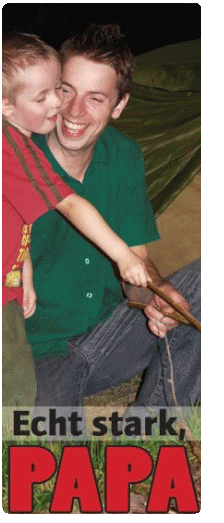
Bausteine für eine väterfreundliche Familienpolitik
von Martin Rosowski, Hauptgeschäftsführer der Männerarbeit der EKD
(Arbeitsgruppe im Rahmen der Mitgliederversammlung der Evangelischen Aktionsgemeinschaft für Familienfragen am 14.09.2006 in Speyer)
Ich erinnere mich an eine Szene aus einem gleichermaßen flotten wie flachen französischen Liebesfilm, in den ich kürzlich zu abendlicher Stunde geriet und die mich im Nachhinein sehr nachdenklich gemacht hat:
Sie: „Wissen Sie, was der Gipfel der Feigheit ist?
Die Angst, ein Kind allein groß zu ziehen!“
Er: schweigt eine Weile und antwortet dann verblüffend:
„Nein! Es ist die Angst, ein Kind zu zweit groß zu ziehen!“
Wenn wir ehrlich sind, dann kennen wir alle diese Momente, in denen die Angst vor der großen Aufgabe, einem Kind den Weg ins Leben zu ermöglichen und es dabei zu begleiten von uns Besitz ergreift – da ist es egal, ob wir bereits Eltern sind, noch nicht sind oder es vielleicht auch nie werden wollen. Oft sind es die Männer, die mit dem Blick in die Zukunft zaudern und zagen.
Männer haben heute davon auszugehen, dass die Erwerbstätigkeit für viele Frauen wesentlicher Bestandteil ihres Selbstverständnisses und ihrer Identität ist. Deshalb ist ein stärkeres familiengestalterisches Handeln von Männern unumgänglich. Viele Männer haben sich bereits für eine gerechtere Rollenverteilung zwischen Erwerbs- und Familienarbeit entschieden. Sie nehmen die Möglichkeiten der Elternzeit in Anspruch, nutzen Angebote zur Teilzeitarbeit oder arrangieren die geteilte Familienarbeit anderweitig. Für sie hat das klassische Männerbild, das ihnen ausschließlich den „Außenbereich“ des Berufes zuweist, längst die Attraktivität verloren. Sie erwarten von der verbindlichen Nähe zu den Kindern und der gleichberechtigten Beziehung zur Partnerin eine Steigerung der Lebensqualität jenseits von Konkurrenz und Erfolg.
Andererseits stehen nicht wenige Männer aber noch immer vor der Erwartung, in ihrem Beruf ständig präsent, mobil und flexibel zu sein. Gerade der Druck auf dem Arbeitsmarkt erhöht die Belastung bei Arbeitsplatzbesitzern wie auch Arbeitsplatz suchenden bzw. arbeitslosen Männern. Und auch die Männer, die neue Wege gehen, treffen auf Blockaden, die durch das Fehlen ausreichender gesellschaftlicher Bedingungen wie durch die alltägliche Realität der Geschlechterverhältnisse gleichermaßen verursacht werden.
Eine aktuelle von der Zeitschrift „Eltern“ in Auftrag gegebene Studie des Berliner Forsa-Institutes geht davon aus, dass Väter die glücklicheren Männer seien. Väter von heute fänden es wunderbar, Kinder zu haben. Deutlich stärker als je eine Vätergeneration zuvor entwickelten sie ein Interesse für ihren Nachwuchs und engagierten sich für Pflege, Betreuung und Erziehung. Während sich früher die meisten Väter mit der Rolle des Familienernährers begnügt hätten, sei es den Vätern von heute wichtig, für ihr Kind da und ihm nahe zu sein.
Doch die fehlenden Rahmenbedingungen bleiben offensichtlich nicht ohne Folgen. Denn jener Eindruck einer neuen Väterlichkeit entspricht nicht annähernd der Realität der tatsächlichen Aufteilung von Haus- und Erwerbsarbeit in deutschen Familien. Zwar konnte durch die Novellierung des Bundeserziehungsgeldgesetzes der abgelösten rot-grünen Bundesregierung der Anteil der Elternzeit in Anspruch nehmenden Väter erheblich gesteigert werden, doch wird noch immer in nur 4,9% der Haushalte, in denen die Elternzeit genutzt wird, diese auch durch den Vater genutzt. Hinter der intensiven Nutzung der Elternzeit durch über 90% der berechtigten Mütter bleibt der Einsatz der Väter auf diesem Feld weit zurück.
Also:
Väter in der Familie – Eine statistische Illusion?
Ein Blick in den Bericht des Bundesministeriums für Familie über die Auswirkungen des Gesetzes aus dem Jahr 2004 macht die Differenz und ihre Ursachen sehr deutlich:
Nach einer Repräsentativbefragung der Bundesregierung aus dem Jahr 2004 nehmen 73% aller Haushalte, die nach dem 01.01.2001 ein Kind bekommen haben, die Elternzeit in Anspruch.
Diese Inanspruchnahme der Elternzeit differenziert sich typologisch wie folgt aus:
I.
60,1% der Mütter sind in Elternzeit und nicht erwerbstätig, während der Vater während der ersten zwei Lebensjahre des Kindes in Vollzeit erwerbstätig ist.
II.
32,2% der Mütter sind in Elternzeit und erwerbstätig (32,2%). D.h. die Mutter nimmt die Elternzeit in Anspruch und ist mindestens ein halbes Jahr während der Elternzeit, überwiegend in Teilzeit, erwerbstätig. Der Vater ist während der ersten zwei Lebensjahre des Kindes hingegen in Vollzeit erwerbstätig.
III.
4,7% der Väter und Mütter sind in Elternzeit und erwerbstätig. Sie nehmen nach der Geburt innerhalb der ersten zwei Lebensjahre die Elternzeit gleichzeitig oder zeitversetzt in Anspruch. Außerdem sind beide Partner (gleichzeitig oder zeitversetzt) zumeist in Teilzeit erwerbstätig.
IV.
0,2% der Väter sind in Elternzeit und nicht erwerbstätig. Der Vater nimmt also die Elternzeit in Anspruch und geht in den ersten zwei Lebensjahren des Kindes keiner Erwerbstätigkeit nach. Die Mutter ist in dieser Zeit voll erwerbstätig.
Will man die Elternzeitmodelle I und II der so genannten traditionellen und die Modelle III und IV der nicht-traditionellen Arbeitsteilung zuordnen, so ergibt sich folgendes im Großen und Ganzen übereinstimmende Bild zwischen Ost- und Westdeutschland:
Insgesamt leben ostdeutsche Paare mit Kindern zu 95,5% in traditionellen Arrangements der Arbeitsteilung, in Westdeutschland hingegen zu 91,8%. Dabei liegt jedoch das Modell der Mutter in Elternzeit mit teilweiser Erwerbstätigkeit im Osten um gut 10% höher als im Westen. Allerdings entscheidet sich in beiden Teilen Deutschlands die überwiegende Mehrheit der Eltern im ersten Lebensjahr des Kindes für den vollen Erwerbsausstieg der Mutter.
Eine nichttraditionelle Arbeitsteilung wählen in den westdeutschen Ländern 5,8 % der die Elternzeit beanspruchenden Haushalte und in den ostdeutschen Ländern 2,4 %.
In den Fallstudien und in der Repräsentativbefragung wurde deutlich, dass auf Grund der existierenden steuerrechtlichen Rahmenbedingungen Väter fast ausschließlich die Elternzeit nur dann beanspruchen, wenn beide Partner in etwa gleich viel verdienen oder die Mutter ein höheres Einkommen erzielt. Bei dieser Einkommenskonstellation wird die Elternzeit von den Vätern in Betracht gezogen, weil keine finanziellen Nachteile zu erwarten sind. Es gibt auch einige wenige Beispiele für eine Väterbeteiligung an der Elternzeit, bei denen andere Faktoren, wie z.B. ideelle Gründe (besonders positive Einstellung gegenüber Familie und Kindern) oder die Arbeitsplatzsituation des Vaters (z.B. nur bedingte Zufriedenheit mit der beruflichen Situation) ausschlaggebend sind.
Das führt zu der Frage, wie die Männer sich selbst sehen und womit sie die dargestellte große Differenz der eigenen Präsenz in der jungen Familie im Gegensatz zu der starken Präsenz der Frauen begründen.
Väter in Deutschland – Das Selbstbild
Dieser Bericht des Bundesministeriums wurde flankiert durch eine repräsentative Bevölkerungsumfrage des Institutes für Demoskopie Allensbach über die Einstellungen junger Männer zu Elternzeit, Elterngeld und Familienfreundlichkeit im Betrieb im Jahr 2005. Dabei ist interessant zu beobachten, wie die befragten Männer selbst die starke Differenz zwischen der Inanspruchnahme von Elternzeit durch Frauen und Männer begründen.
Als eindeutigen Hauptgrund geben junge Männer bis 44 Jahre in ihren Antworten finanzielle Motive an. 82 Prozent von ihnen erklären: "Die Einkommensverluste sind meist viel größer, wenn der Vater zu Hause bleibt, als wenn die Mutter zu Hause bleibt." Diese Aussagen werfen natürlich ein bezeichnendes Licht auf die bekannte Ungleichheit der Einkommen von Frauen und Männern in Deutschland. Sie resultiert vorrangig aus eindeutig genderbedingten unterschiedlichen Tätigkeiten in unterschiedlichen Branchen und aus unterschiedlichen Arbeitsverhältnissen. Diese Ungleichheit prägt noch immer einen Großteil der Partnerschaften in unserem Land. Wenn also der in der Regel mehr verdienende Mann in der Familie sich zur Kinderbetreuung und zum Ausscheiden aus dem Beruf entschließt, ist der Einkommensverlust für die Gesamtfamilie entsprechend höher als im Falle der Mutter.
Die als zweitwichtigste Motivationslage gedeutete Argumentation bezieht sich auf den Bereich der beruflichen Situation. Mögliche Nachteile in der beruflichen Laufbahn und der diese Sorge bedingende Ehrgeiz werden von 74 % bzw. 55 % der jüngeren Männer als Hinderungsgrund für die Nutzung der Elternzeit genannt.
Sozialisationsgründe und traditionelle Rollennormen rangieren eher dahinter.
In den unteren Signifikanzbereichen tauchen dann Informationsdefizite, fehlende politische und öffentliche Unterstützung oder mangelndes Kompetenzgefühl auf.
Bedeutend weniger Männer geben als Hinderungsgrund den gesellschaftlichen Statusverlust an, als ihnen das von den als Kontrollgruppe befragten Frauen unterstellt wird.
Die Analyse der sozialen Differenzierung der Befragtengruppen zeigt ein deutliches Schwergewicht der beruflichen Karriere-Argumente bei den höher Gebildeten und den Besserverdienenden. Doch im Übrigen setzen alle Gruppen ähnliche Schwerpunkte: finanzielle Einbußen und Furcht vor beruflichen Nachteilen werden überall mit Abstand am meisten genannt.
Trotz aller positiven Entwicklungen in der Diskussion um die Geschlechtergerechtigkeit stellt die deutliche Diskrepanz zwischen weiblicher und männlicher Beteiligung an der Erziehungsarbeit und -verantwortung ein statistisches Faktum in unsrer Gesellschaft dar. Die Aufhebung dieses Missverhältnisses gehört zum erklärten Willen der aktuellen Koalitionsregierung wie bereits ihrer rot-grünen Vorgängerin. Die Motivationen mögen jeweils anders gelagert sein. Doch deutlicher Konsens besteht in der Einsicht: Eine Gesellschaft, die die Verantwortung für die Reproduktion einseitig den Frauen zuweist, wird auf Dauer nicht zukunftsfähig sein!
Bündnisse für Väter und Familien
Die Konzeption der Bundesministerin von der Leyen für das neue Elterngeld greift das Argument der Männer auf, vor allem finanzielle Einbußen hinderten sie an einer stärkeren Wahrnehmung der Verantwortung in der Familie. Das geplante Elterngeld soll sich am Nettoeinkommen des Elternteils orientieren, das in die Erziehungszeit geht. Für den Zeitraum eines Jahres soll der oder die Erziehende dann eine finanzielle Entschädigung von bis zu 65% des letzten Nettogehaltes bekommen. Dies würde bedeuten, dass die Entscheidung, ob Mann oder Frau in die Elternzeit gehen, nicht mehr von der Frage des Mehrverdieners abhängig wäre. Darüber hinaus sollen im neuen Gesetz zwei Monate des Bezuges allein dem Mann vorbehalten bleiben. Sollte dieser die Elternzeit nicht in Anspruch nehmen, würde sich die Dauer des Elterngeldbezuges also auf 10 Monate verkürzen.
Man erwartet sich von dieser vor allem an die Männer gerichteten Maßnahme einen deutlichen Anstieg der Inanspruchnahme der Elternzeit durch Väter sowie einen durch die gleichberechtigte Wahrnahme der Erziehungsverantwortung bedingten Anstieg der Bereitschaft von Frauen und Männern, Eltern zu werden. Im Hinblick auf die Erhöhung der Zahl der Väter in Elternzeit und somit die Gleichstellung von Frauen und Männern insgesamt hat man mit solchen Maßnahmen in Schweden beispielsweise positive Erfahrungen gemacht – die Geburtenrate allerdings blieb davon auch in Schweden unberührt. Insgesamt scheinen mir die so genannten Papa-Monate, die die Männerarbeit der EKD im Übrigen schon seit Jahren in die Diskussion gebracht hat, ein geeignetes Instrument zu sein, Väter in ihrer Familienverantwortung zu stützen. Doch ohne eine nachhaltige Berücksichtigung des Faktors „Zeit“ in der Familienförderung werden auch solche punktuellen Impulse keine langfristige und grundlegende Wirkung zeigen.
Die Auswertung der letzten Zeitbudgetstudie durch die Männerforscher Rainer Volz und Peter Döge haben Hoffnungsvolles zu Tage gefördert. Nach ihren Berechnungen verbringen Männer heute zunehmend mehr Zeit mit Familienarbeit. Während sich das häusliche Zeitengagement von Männern um täglich ca. 15 Minuten erhöht, sinkt es bei den Frauen um ungefähr diese Zeiteinheit parallel ab. Das liegt zum einen an der Technisierung vieler Bereiche des häuslichen Arbeitens und zum anderen in der Tat an einer verstärkten Verantwortung von Männern in diesem Bereich, wenn Kinder da sind.
Dies stützt die Ergebnisse der von der evangelischen und katholischen Männerarbeit realisierten empirischen Männerstudie von 1998, die damals überdeutlich besagten:
In der Nähe des Vaters zum Kind, in der aktiven Wahrnahme von Vaterschaft liegt das entscheidende Kriterium für „neues Mannsein heute“. (Paul M. Zulehner/Rainer Volz, Männer im Aufbruch. Wie Deutschlands Männer sich selbst und wie Frauen sie sehen. Ein Forschungsbericht, Ostfildern 1998). Daran hat sich, wie die Neuauflage der vergleichbaren Studie in Österreich deutlich macht, wenig geändert. Im Gegenteil, die Gruppe der Männer, die veränderte Rollenmuster leben, steigt an.
Zugleich steigt jedoch auch die Gruppe junger Männer an, die sich an traditionellen Rollenmustern orientieren. Die künftige Bruchlinie, so ist mit Zulehner anzunehmen, wird sich nicht mehr vorrangig zwischen Männern und Frauen als vielmehr zwischen traditionellen und modernen Lebensentwürfen, sowie zwischen einem Leben mit und einem Leben ohne Kinder vollziehen.
Gerade hier ist die Wirtschaft, sind die Arbeitgeber gefordert. Die Forderungen des Bundespräsidenten in diese Richtung klingen da sehr deutlich:
„Es ist kurzsichtig, wenn Arbeitgeber den jederzeit verfügbaren Arbeitnehmer vorziehen vor Mitarbeitern, die Mutter oder Vater sind. … Ein vorausschauender Unternehmer organisiert Arbeit so, dass sie optimal erledigt wird - für ihn selbst wie für seine Mitarbeiter. Ich wünsche mir mehr Unternehmen, die erkennen: Investitionen in die bessere Vereinbarkeit von Familien- und Berufsarbeit zahlen sich aus. Von 25 Prozent Rendite spricht eine viel zitierte Studie.“
Bei der viel zitierten Studie handelt es sich um die Prognos-Studie über betriebswirtschaftliche Effekte familienfreundlicher Maßnahmen. Darin stellt Prognos fest, dass Unternehmen langfristig von familienfreundlichen Maßnahmen, zu denen u.a. Teilzeitangebote, flexible Arbeitszeiten und Wiedereinsteigerprogramme zählen, profitieren, da sich auf diese Weise Neubeschaffungs- und Wiedereingliederungskosten und Kosten für Überbrückungs- und Fehlzeiten von Mitarbeiterinnern reduzieren.
Doch der Schein trügt nicht, dass hier vorrangig Frauen im Visier der Überlegungen stehen. Die von Wirtschaft und Politik für den Mann vorgesehenen Arbeitsmodelle gehen dagegen nach wie vor in Richtung auf den Vollzeitarbeitnehmer mit steigender Wochen- und Lebensarbeitszeittendenz. Nicht auf die kreative Vielfalt der Arbeitszeitgestaltung wird in Krisenzeiten gesetzt, sondern auf das Maximum an Präsenz. So lange jedoch die rollenkonservative Zuweisung der Erziehungs- und Haushaltsverantwortung an die Frauen nicht nachhaltig strukturell überwunden ist, werden klassische Arbeitszeitmodelle mit Tendenz zur Verlängerung auf den Mann zugeschnitten bleiben. Familienfeindlich bleiben sie in jedem Fall.
Bischof Huber fordert in seiner familienpolitischen Grundsatzrede, Mitte des Jahres in Berlin, zu Recht die stärkere Übernahme von Verantwortung durch die Männer. Doch dabei ist allerdings wenig hilfreich, wenn diese Forderungen auf einer Defizitanalyse der Männer beruhen und die positive Entwicklung eben gerade nicht wahrnehmen:
„Auch die Rollenbilder der Männer und Väter haben sich verändert, aber doch bei weitem nicht in dem Maße wie die Rollenbilder der Frauen und Mütter. Die Erwerbstätigenquote der Frauen in Deutschland mag immer noch steigerungsfähig sein; doch wohin es führt, wenn der Anteil der Männer an der Erziehungs- oder Elternzeit so gering bleibt wie bisher, ist leicht vorstellbar.“
Es gibt sicherlich vielfältige Räume, in denen Männer ihre Erziehungsverantwortung wahrnehmen können, doch sie müssen vom Vater gefordert und von der Mutter freigegeben werden. Da sich Männer hier noch immer auf ungewohntem Terrain bewegen, brauchen sie unser aller Unterstützung. Auch von der Politik. So ist es natürlich eine Ermutigung wenn der Bundespräsident sich noch mehr Väter wünscht:
„die sich Zeit für ihre Kinder nehmen, die zum Beispiel auch in die Elternzeit gehen. Ich wünsche mir, dass sie dafür nicht mitleidige Blicke und süffisante Bemerkungen von Kollegen oder Freunden ernten. Ich wünsche mir verständnisvolle Arbeitgeber, die Vätern keine Steine in den Weg legen, wenn sie im Beruf mal kürzer treten wollen. Und ich wünsche mir, dass die Frauen auch zulassen, wenn Männer sich einbringen - obwohl sie möglicherweise bei der einen oder anderen Erziehungs- und Haushaltsfrage andere Vorstellungen haben.“
Doch das setzt eine Familienpolitik und ein gesellschaftliches Familienbild voraus, die die Lebenswirklichkeiten Frauen und Männern endlich gleichermaßen in den Blick nehmen, sich für die Verwirklichung ihrer Lebensvorstellungen stark machen und sie dabei in ihren jeweils spezifischen Bedürfnissen unterstützen. Denn letztlich brauchen wir kein frauen- oder männerfreundliches Gemeinwesen, sondern ein Gemeinwesen, das das Leben fördert.
|