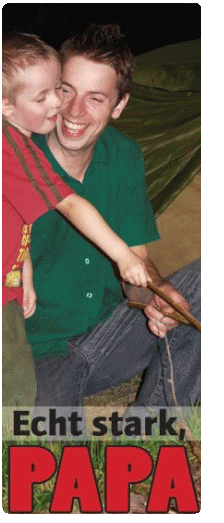|
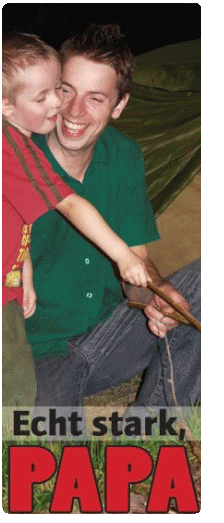
Familienpolitische Erklärung der Männerarbeit der EKD zu den Reformvorhaben der Bundesregierung
Kassel, im Februar 2006
Der Vorstand der Männerarbeit der EKD
Die Männerarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) begrüßt die Tatsache, dass familienpolitische Reformen in den Vorhaben der neuen Bundesregierung einen hohen Stellenwert erhalten. Auf der Grundlage ihrer langjährigen praktischen Erfahrungen in der Arbeit mit Vätern und Kindern sowie in der Genderdiskussion aus männerpolitischer Perspektive nimmt die Männerarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland zu den Reformvorhaben Stellung.
Die Situation von Familien wird in Deutschland gegenwärtig vehement diskutiert. Folie für solche Diskussionen bilden die demografischen Entwicklungen, die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit, die Sorge um die gleichberechtigte Teilhabe am Erwerbsleben oder die bildungs- und erziehungspolitischen Herausforderungen nach der Pisastudie. Es geht um verlässliche soziale Umfelder für die Entwicklung von Kindern ebenso wie um neue Rollenmodelle für Frauen und Männer, um Familie und Beruf in Einklang bringen zu können.
Männer haben heute davon auszugehen, dass die Erwerbstätigkeit für viele Frauen wesentlicher Bestandteil ihres Selbstverständnisses und ihrer Identität ist. Deshalb ist ein stärkeres familiengestalterisches Handeln von Männern unumgänglich. Viele Männer haben heute bereits eine positive Einstellung zu ihrer Vaterrolle. Deutlich stärker als je eine Vätergeneration zuvor engagieren sie sich für Pflege, Betreuung und Erziehung. Vätern von heute ist es wichtig, für ihr Kind da und ihm nahe zu sein. Andererseits stehen nicht wenige Männer aber noch immer vor der Erwartung, in ihrem Beruf ständig präsent, mobil und flexibel sein zu müssen. Gerade der Druck auf dem Arbeitsmarkt erhöht die Belastung bei Arbeitsplatzbesitzern wie auch Arbeitsplatz suchenden bzw. arbeitslosen Männern.
Diese Spannung bleibt offensichtlich nicht ohne Folgen. Denn jener Wunsch nach einer aktiven Vaterschaft entspricht nicht annähernd der Realität der tatsächlichen Aufteilung von Haus- und Erwerbsarbeit in deutschen Familien. Zwar konnte durch die Novellierung des Bundeserziehungsgeldgesetzes der Vorgängerregierung der Anteil der Elternzeit in Anspruch nehmenden Väter erheblich gesteigert werden, doch wird noch immer in nur 4,9% der Haushalte, in denen die Elternzeit genutzt wird, diese auch durch den Vater genutzt. Hinter der intensiven Nutzung der Elternzeit durch über 90% der berechtigten Mütter bleibt der Einsatz der Väter auf diesem Feld weit zurück.
Die neue Bundesregierung will mit einer Reform der Familienpolitik unter anderem auch diesem Missverhältnis begegnen. In dieser Frage kann sie auf die Unterstützung der Männerarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland rechnen. Die Beteiligung von Männern an der Haus- und Erziehungsarbeit wird in erheblichem Maße von einer Finanzierung des Verdienstausfalles abhängen. Die Orientierung des neuen Gesetzesentwurfes am Nettolohn des betroffenen Elternteils sowie die Verknüpfung der vollen Anspruchsberechtigung an die zumindest anteilige Inanspruchnahme durch den Vater zielt daher in die richtige Richtung. Ein Abbau von Teilzeitarbeitsplatzangeboten und die damit in den letzten Monaten einhergehende Diskussion über die Verlängerung der Wochenarbeitszeit hingegen wird sich eher hemmend auswirken.
Das von der Vorgängerregierung begonnene Gespräch mit der Wirtschaft über die Rahmenbedingungen einer familienfreundlichen Gesellschaft sollte vor diesem Hintergrund fortgesetzt und ausgebaut werden. Dabei ist noch einmal auf die Ergebnisse der Prognos-Studie über betriebswirtschaftliche Effekte familienfreundlicher Maßnahmen hinzuweisen. Außerdem verdienen die Ergebnisse der Allensbach-Umfrage mit jungen Männern hinsichtlich ihrer Einstellung zu Elternzeit, Elterngeld und Familienfreundlichkeit im Betrieb aus dem Jahr 2005 Beachtung, in der die befragten Männer solche Maßnahmen der Arbeitgeber zur Förderung des Männeranteils an der Elternzeit favorisierten, die sich auf flexible Arbeitszeiten, ausreichende Kinderbetreuung, Teilzeit- und Heimarbeitsplätze sowie Sonderurlaubsregelungen zur Kinderbetreuung bezogen.
Mit großer Sorge registrieren wir allerdings das Fehlen der sozialen Komponenten des Reformvorhabens. Die Situation der Alleinerziehenden, der Arbeitslosenfamilien, der Hartz IV-Empfänger oder der Studentenelternschaft scheint nicht im Blick zu sein. Menschen ohne Erwerbseinkommen dürfen nicht zu den Verlierern der Reform werden. Bisherige Empfangsberechtigte des alten Erziehungsgeldes ohne Einkommen müssen auch weiterhin diese Leistung erhalten. Die Männerarbeit setzt sich für die Wahlfreiheit von Lebensentwürfen und Familienkonstellationen ein. Auch klassische Familienmuster bedürfen des Schutzes und der Förderung.
Die Große Koalition weiß sich in ihrem Koalitionsvertrag einer Gleichstellungspolitik verpflichtet, die sich an den Erwartungen und Lebensentwürfen von Männern und Frauen in allen Lebensbereichen orientiert. Gezielte steuerliche Anreize zur Schaffung privater Arbeitsplätze in der Erziehung und Betreuung sollen daher die Bemühungen um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf flankieren. Die Planzahlen zur Erhöhung des Betreuungsangebotes, vor allem für die unter 3jährigen Kinder, sollen erfreulicher Weise weiter fortgeschrieben werden. Doch die Reduzierung des für die familienpolitischen Reformen vorgesehenen Haushaltes lässt an der Realisierbarkeit dieses Anliegens zweifeln. Es wäre daher fatal, wenn durch die steuerlichen Anreize für die Schaffung von Beschäftigungsverhältnissen im Familienbereich die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sich zu einem Privileg der Besserverdienenden entwickeln würde. Wenn die Wahlfreiheit der Lebensentwürfe gewollt ist, dann müssen die entsprechenden Rahmenbedingungen für alle gewährleistet sein. Ohne ein bedarfsgerechtes öffentliches Betreuungsangebot bleiben daher alle bisher unternommenen Bemühungen zur Stärkung der Familien und der gleichberechtigten Aufgabenteilung der Geschlechter Stückwerk.
Die gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft machen eine Familienpolitik nötig, die die Lebenswirklichkeiten von Frauen, Kindern und endlich auch Männern gleichermaßen in den Blick nimmt, sich für die Verwirklichung ihrer Lebensvorstellungen stark macht und sie dabei in ihren jeweils spezifischen Bedürfnissen unterstützt.
|